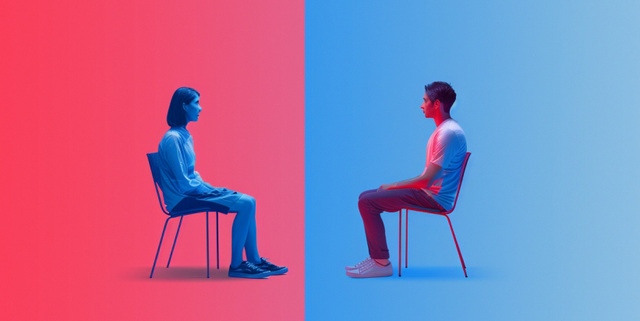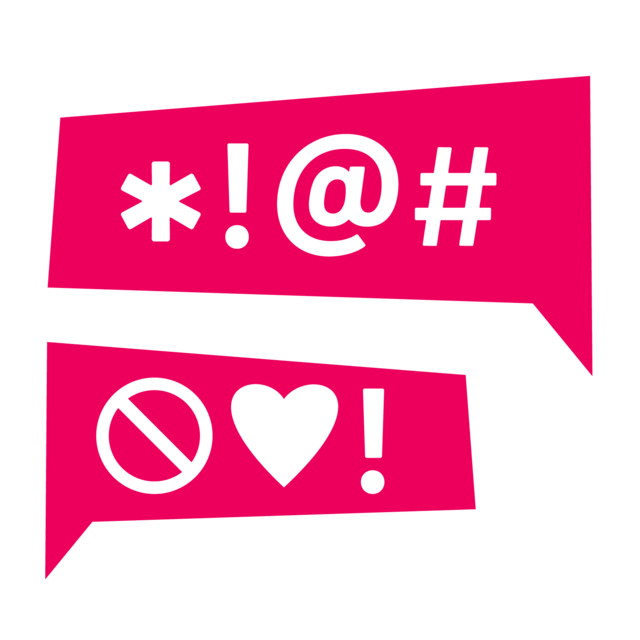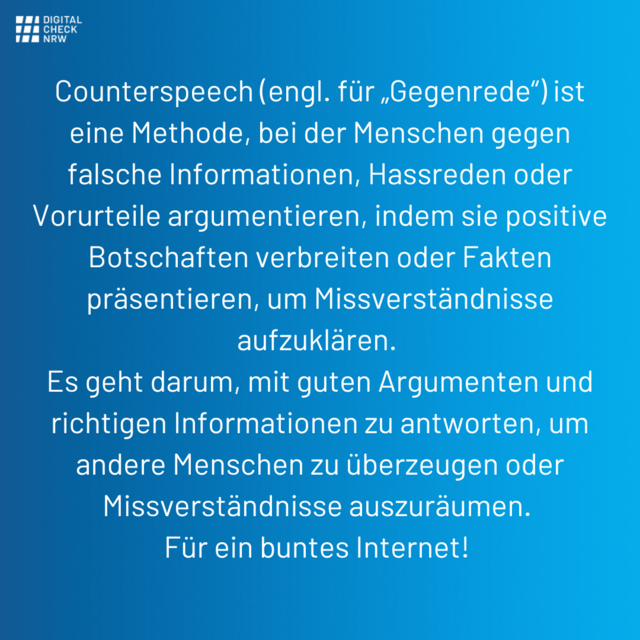ADIRA- Antidiskriminierungsberatung und Intervention bei Antisemitismus und Rassismus
www.adira-nrw.de
Amadeu-Antonio-Stiftung (Informationen zum Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus)
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rechtsextremismus-rechtspopulismus/was-kannst-du-tun-rechtsextremismus/
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
www.antidiskriminierungsstelle.de
BackUP - Beratung für betroffene rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt
https://backup-nrw.org/
Beratungsnetzwerk Grenzgänger
https://www.grenzgaenger.nrw/
Beratungsstelle Radikalisierung
https://www.beratungsstelle-radikalisierung.de/DE/Startseite/startseite_node.html
Beratungsstellen-Netzwerk des BAMF (Netzwerkkarte stellt anschaulich das bundesweite Beratungsstellen-Netzwerk der Beratungsstelle "Radikalisierung" dar)
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/deradikalisierung-standardhandreichung-netzwerkkarte-2020.html?nn=282388
Bundesverband RIAS e.V. - Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e.V.
https://report-antisemitism.de/bundesverband-rias/
Bundeszentrale für politische Bildung (Hinweise zum Umgang mit Rechtsextremismus)
https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/236165/umgang-mit-rechtsextremismus/
Diakonie Deutschland (Handreichung „Umgang mit Rechtspopulismus und Rechtsextremismus“)
https://www.diakonie.de/informieren/infothek/handreichung-zum-umgang-mit-rechtspopulismus-und-rechtsextremismus
EXIT Deutschland - Ausstiegshilfe Rechtsextremismus
https://www.exit-deutschland.de/start/
HateAid (für Menschenrechte im digitalen Raum)
https://hateaid.org/
Meldestelle Respect (Meldestelle für Hass und Hetze im Internet)
meldestelle-respect.de
Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation (Informationen zu Hassrede und Gewalt im digitalen Raum)
https://kompetenznetzwerk-hass-im-netz.de/
ufuq.de - Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus.
https://www.ufuq.de/
SABRA - Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus
https://www.sabra-jgd.de/
Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt unterstützen Betroffene von rechten Angriffen
https://verband-brg.de/
Vielfalt-Mediathek (Bildungsmaterialen und Broschüren zum Themenfeld Rechtsextremismus)
https://www.vielfalt-mediathek.de/themenfeld/rechtsextremismus
Violence Prevention Network
https://violence-prevention-network.de/ausstieg-2020/
Wegweiser Nordrhein-Westfalen – Stark ohne islamistischen Extremismus
https://wegweiser.nrw.de/
WEISSER RING - Unterstützung von Kriminalitätsopfern
https://weisser-ring.de/
Außerdem:
Nummer gegen Kummer e.V. - Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern
116 111 (Mo-Sa von 14-20 Uhr)
https://www.nummergegenkummer.de/
6 Tipps für richtiges Verhalten bei Radikalisierung
https://www.zivile-helden.de/radikalisierung/6-tipps-fuer-richtiges-verhalten-bei-radikalisierung/
NinANRW (Überblick über die wichtigsten rechtsextremen Codes und Symbole)
https://nina-nrw.de/codes-und-symbole/